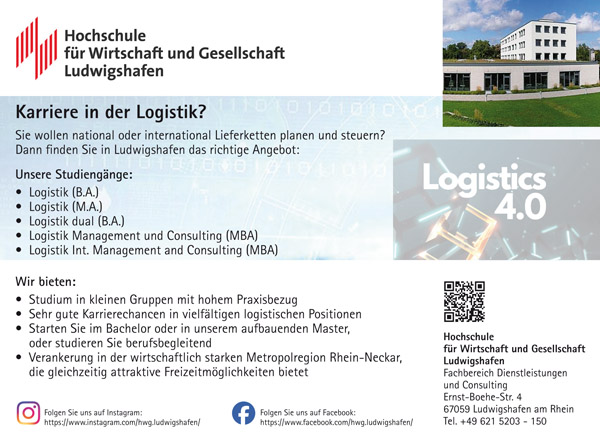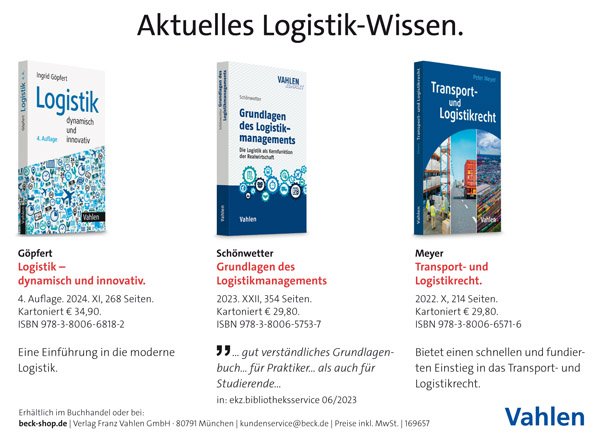Logistik ist ein wichtiger Wirtschaftsbereich. Ohne sie geht in der hochmobilen Welt von heute nichts. Viele Hochschulen bieten Logistik-Studiengänge an.
Studienreport Logistik/Supply Chain Management
Ohne Logistik geht nichts
Wer auf der Autobahn unterwegs ist, staunt oft nicht schlecht, wie viele Lastwagen dort jeden Werktag unterwegs sind. Viele durchqueren Europa von einem Ende zum anderen. Nicht anders die Güterzüge, die Tag und Nacht beladen mit Waren durch Europa rattern. Die Wasserstraßen Europas werden von unzähligen Frachtkähnen befahren, sollte nicht eine Trockenheit ihnen einen Strich durch die Rechnung machen wie zuletzt 2022 in Teilen Europas. Und am Himmel streben Cargo-Flugzeuge ihrem Ziel zu, das ebenfalls irgendwo in Europa oder in fernen Ländern liegt. Diese Ziele werden auch von großen oder sogar riesigen Containerschiffen angesteuert, die oft wochenlang die sieben Meere befahren.
Es gibt viele, die von diesem gigantischen Transportverkehr regelrecht fasziniert sind, und überlegen, ob das nicht ein Berufsfeld für sie wäre. Obwohl er meist ziemlich unsichtbar, gewissermaßen „hinter den Kulissen“ stattfindet. Erst wenn es zu massiven Lieferproblemen wie während der Corona-Pandemie kommt, wird den meisten bewusst, was alles an Logistik erforderlich ist, damit alle Zahnräder ineinandergreifen und die gewünschten Waren in den Supermarktregalen — oder die Arzneimittel in den Apotheken — bereitliegen. So waren die Medien während der Pandemie voll von Berichten und Bildern, die zeigten, wie sich die Schiffe vor den riesigen Häfen von Shanghai oder Long Beach bei Los Angeles stauten, womit das Schlagwort von den „Lieferkettenproblemen“ plötzlich in aller Munde war.
 Damit die Wirtschaft floriert, müssen die Räder rollen. Dafür sorgt die Logistik oder das Supply Chain Management, wie man heute gern sagt. Die TH Ostwestfalen-Lippe bietet an ihrem Innovation Campus Lemgo zwei Logistikstudiengänge an, die von Prof. Nicholas Boone geleitet werden. Weiter ...
Damit die Wirtschaft floriert, müssen die Räder rollen. Dafür sorgt die Logistik oder das Supply Chain Management, wie man heute gern sagt. Die TH Ostwestfalen-Lippe bietet an ihrem Innovation Campus Lemgo zwei Logistikstudiengänge an, die von Prof. Nicholas Boone geleitet werden. Weiter ...
Doch Logistik hat nicht nur mit nationalem oder internationalem Transport zu tun. Es gibt auch interne Logistik. Dabei geht es vor allem um optimale Lagerhaltung, damit alles blitzschnell zugeordnet, gefunden und an die Kunden ausgeliefert werden kann. Logistiker sind also auch damit befasst, Prozesse zu optimieren und Abläufe zu planen und sie programmieren zusammen mit ITlern inzwischen auch Transport- und Lagerroboter.
In Deutschland arbeiten über drei Millionen Menschen in der Logistikbranche, womit sie nach der Autoindustrie und dem Handel die drittgrößte ist. Allein das zeigt, wie wichtig sie ist. Denn im Prinzip hat fast jedes Unternehmen etwas mit Logistik zu tun, von der Materialbeschaffung bis zum Vertrieb seiner Produkte. Manchmal erledigt es diese Aufgaben selbst und unterhält beispielsweise einen eigenen Fuhrpark, oder man bedient sich außenstehender Dienstleister. Oft — wie in der Verlagsbranche — bieten diese einen Service aus einer Hand: von der Lagerung über die Auslieferung, die Rechnungsstellung und das Inkasso.
Logistik ist also eine komplexe Angelegenheit, auch weil alles kostengünstig und meistens auch schnell erfolgen soll. Ganz besonders knapp ist die Zeit bei „Just-in-time“-Lieferungen, bei denen die Komponenten, die — etwa in Autos — verbaut werden sollen, erst an dem Tag angeliefert werden, da sie in der Produktion benötigt werden. Das spart Lagerkosten. Das Konzept wurde in Japan erfunden und zuerst von Toyota eingesetzt.
Überhaupt kann es in der Logistik oder im Supply Chain Management, wie sie heute gern genannt wird, oft hektisch zugehen. Insbesondere, wenn es um Saisonware geht, die rechtzeitig — wie zu Weihnachten — in den Geschäften sein muss. Langweilig wird es Logistikmanagern sicher nicht.

Bei so viel Wissen, das Logistik erfordert, ist es kein Wunder, dass das Thema längst von den Hochschulen aufgegriffen wurde und gelehrt wird. Weit über 40 Jahre ist es her, dass die FH Bremerhaven als bundesweit erste Hochschule einen Studiengang Logistik einrichtete. Die Hafenstadt an der Wesermündung, die zum Stadtstaat Bremen gehört, war dafür prädestiniert, gehen doch von hier Produkte „Made in Germany“ in alle Welt.
Die Bremerhavener hatten einen guten Riecher, denn Logistik entwickelte sich rasch zum Trendfach im Exportland Deutschland. Inzwischen ist es aus dem Angebot deutscher Hochschulen nicht mehr wegzudenken. Über hundert haben Logistik als eigenständigen Studiengang oder als Schwerpunkt innerhalb eines anderen Fachs im Angebot. Nicht alle heißen „Logistik“, „Logistikmanagement“ oder „Supply Chain Management“. Man trifft auch auf International Logistics, Global Logistics, Maritime Logistics, Informationslogistik, digitale Logistik und umweltorientierte Logistik. Sogar Chemie- und Pharma- sowie Luftfahrtlogistik sind im Angebot. Und es muss nicht unbedingt ein Vollzeit-Präsenzstudium sein. Man kann Logistik auch berufsbegleitend per Fern- und Onlinestudium oder an einer dualen Hochschule studieren.
 Die Hochschule Ludwigshafen liegt in einer wirtschaftlich starken Region, in der regelmäßig Logistikfachleute gesucht werden. Das Bachelor- und das Masterstudium Logistik sind genau der richtige Einstieg in dieses wichtige Fachgebiet und in diese dynamische Branche, weiß Studiengangsleiter Prof. Wolfgang Müller. Weiter ...
Die Hochschule Ludwigshafen liegt in einer wirtschaftlich starken Region, in der regelmäßig Logistikfachleute gesucht werden. Das Bachelor- und das Masterstudium Logistik sind genau der richtige Einstieg in dieses wichtige Fachgebiet und in diese dynamische Branche, weiß Studiengangsleiter Prof. Wolfgang Müller. Weiter ...
Dieses Angebot macht den Deutschen so leicht keiner nach. Ihr Faible für Logistik — laut „Gabler Wirtschaftslexikon“ die integrierte Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle der Güterflüsse und der güterbezogenen Informationen von der Entstehung bis zum Verbrauch — kommt nicht von ungefähr. Als exportorientierte Nation im Herzen Europas ist man auf einen reibungslosen Güterverkehr angewiesen, ob zu Wasser, zu Lande oder in der Luft. Zudem ist Deutschland dicht besiedelt. Jede größere Störung des Bahn-, Flug- oder Autoverkehrs hat deshalb gleich gravierende Konsequenzen — wie bei einem Uhrwerk, das stillsteht, sobald sich ein Rädchen nicht mehr bewegt. Umso wichtiger, dass nichts aus dem Takt gerät.
Die Logistik hat im Laufe der Zeit einige Wandlungen erfahren. Ging es früher — vereinfacht gesagt — darum, ein Objekt pünktlich und unbeschadet von A nach B zu bringen — laut der Seven-Rights-Definition von Plowman ist Logistik die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden und zu den richtigen Kosten —, rückte mit der Globalisierung die gesamte Wertschöpfungkette in den Fokus. Aus dem Logistikmanager wurde der Supply Chain Manager, dessen ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen Effizienz- und Qualitätsvorteile ermöglichen soll, die sich in Wettbewerbsvorteile ummünzen lassen. Neu ist auch, dass er den Wertschöpfungsprozess „vom Ende her“, also vom Kunden her, denkt. Deshalb stehen beim Supply Chain Management nun Konzepte wie ERP (Enterprise Resource Planning) und ECR (Efficient Consumer Response) im Mittelpunkt.
Inzwischen hat auch die Digitalisierung für Veränderungen gesorgt. Mit der steigenden Bedeutung von Daten für den Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsprozess lösen sich die traditionellen Wertschöpfungsketten zunehmend auf. An ihre Stelle treten dynamische Netzwerke: Fließsysteme, die ständig optimiert und neu konfiguriert werden. So wird der Supply Chain Manager nach und nach zum Flow Manager — eine Mischung aus IT-Spezialist, Projektmanager und Value-Chain-Optimierer, der auch noch die Anforderungen der Umwelt in seinen Überlegungen berücksichtigt.
Überhaupt ist Nachhaltigkeit heute ein wichtiges Thema in der Logistikbranche. Denn Logistik bedeutet vor allem Transport, und hier werden viele Treibhausgase freigesetzt. Generell rangierte der Verkehr 2021 nach der Energiewirtschaft und der Industrie noch an dritter Stelle, wobei der Individualverkehr einen Teil ausmacht. Transporte verursachen ein Viertel der Treibhausgasemissionen in der EU.
Die Nachhaltigkeit lässt sich in vielen Bereichen verbessern. Das beginnt mit der E-Mobilität, die bei großen Lastwagen wegen der schweren Batterien jedoch ein Problem ist, bei kleinen Transportern lässt es sich eher lösen. E-Busse gibt es bereits, aber noch zu wenige. E-Flugzeuge werden wiederum noch auf sich warten lassen. Fahrzeuge können jedoch besser ausgelastet und Leerfahrten vermieden werden. Das spritschonende Fahren kann auch noch oft verbessert werden. Das autonome Fahren bietet hier ebenfalls Chancen. Wichtig sind auch umweltschonende Verpackungsmaterialien.
Viele Transport- und Logistikunternehmen haben sich Nachhaltigkeitsziele gesetzt und bieten bereits nachhaltige Lösungen an. Doch wie Kritiker meinen, bleiben die meisten weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Da viele Logistik-Studiengänge Nachhaltigkeit inzwischen zum Thema gemacht haben und die junge Generation wegen des Klimaschutzes hier immer mehr Forderungen stellt, stehen die Chancen gut, dass junge Logistikmanager mit einem stark erhöhten Umweltbewusstsein in den Unternehmen nachrücken und Nachhaltigkeit zu einem ernsten und unumgehbaren Dauerthema machen.
Wer sich für ein Studium der Logistik bzw. des Supply Chain Management interessiert, muss wissen, dass es ein interdisziplinäres Fach ist, das betriebswirtschaftliches und technisches Wissen vereint. Je nachdem, wo man studiert, steht das eine oder andere im Vordergrund. Manhmal hängt es auch davon ob, ob der Studiengangsleiter Betriebswirt oder Ingenieur ist.
Für alle Logistik-Studiengänge gilt: Man muss zwar kein Einstein sein, sollte jedoch mit Mathematik und mit Technik nicht auf Kriegsfuß stehen. Schließlich bedeutet der Begriff, wörtlich übersetzt, „praktische Rechenkunst“.
Die Berufsaussichten für Logistker sind ausgesprochen gut. Auch wenn die Globalisierung aufgrund der Pandemie etwas zurückgedreht wurde, ist sie nicht verschwunden. Auch das Reshoring, das zum Teil stattfindet, bei dem Produktionen in die Heimatländer der Unternehmen — oder in preisgünstige Nachbarländer — zurückverlagert werden, ändert nichts an den Berufsaussichten. Auch Arbeitgeber stehen genug bereit: Von der Industrie mit eigenen Logistikabteilungen bis zu zahllosen Dienstleistern, wozu auch Airlines, die Bahn, DHL und viele Speditionsunternehmen zählen.
© wisu1123/1046